Interessante Begriffe in der Gesangswelt: Druck und Kompression
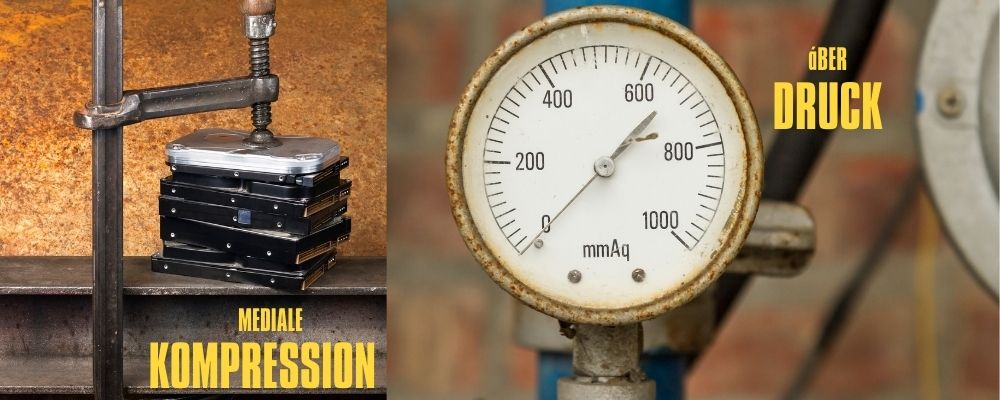
In der Stimmpädagogik sprechen wir immer wieder über den subglottischen Luftdruck und die mediale Kompression. Schauen wir uns doch mal die beiden Begriffe “Druck” und “Kompression” genauer an.
Auf der einen Seite wollen wir zu viel Druck vermeiden, aber die Stimme soll auch im Popularbereich in manchen Stilistiken druckvoll klingen. Wie kann das zusammen gehen?
Und wir reden von Luftdruck. Ist das damit gemeint? Sollte sich der Luftdruck erhöhen? Was meint das aber? Wer drückt da von wo gegen wen? Und wie viel davon brauchen wir, wie viel davon ist ungesund? Das sind alles Fragen, die sich Sänger:innen natürlich immer wieder stellen.
Oft glauben wir, wenn wir mit jemandem über Gesangstechnik sprechen, dass wir einer Meinung sind, da wir gleiche Begriffe benutzen. Aber wenn wir nicht vorher abklären, was unsere Terminologie ist, was wir unter einem Fachbegriff wirklich verstehen, dann bemerken wir manchmal erst mitten in einer Diskussion, dass wir von komplett unterschiedlichen Grundannahmen ausgegangen sind.
Deshalb finden wir es hilfreich, die Terminologie vorher zu klären. Denn sonst wird es schwierig, sich wirklich zu verstehen und sich auszutauschen.
Für diesen Blog-Artikel habe ich zwei Begriffe herausgenommen, die wir in der Rabine-Methode häufig benutzen: Die mediale Kompression und den subglottischen Luftdruck.

Die mediale Kompression
Wenn wir von medialer Kompression sprechen, meinen wir den Druck, mit dem sich die Stimmlippen beim Singen aneinander legen. Sie kann gut geregelt sein, sie kann zu wenig sein. Bei zu wenig medialer Kompression hören wir eine sehr hauchige Stimme. Oder wir pressen die Stimmlippen aneinander, dann haben wir zu viel mediale Kompression und einen eher harten Klang.
Im klassischen Gesang versuchen wir zu erreichen, dass die Stimmlippen eine optimale mediale Kompression haben. Das bedeutet, dass die Stimmlippen gut schließen, der Ton klar und ohne Nebengeräusche und flexibel genug ist und sich ein natürliches Vibrato einstellen kann. Bei einer solchen Einstellung kann auch der Bernoulli Effekt effektiv wirken. Er sorgt dafür, dass die Stimmlippen automatisch aneinander gesaugt werden.
Innerhalb des Populargesangs suchen wir aber immer wieder Möglichkeiten, diesen Modus zu verlassen, weil wir andere Klänge mit unserer Stimme erreichen wollen.
Wir haben Techniken wie Belting oder auch Effekte, die wir mit unserer Stimme produzieren können.
Bei einem funktionalen Belting beispielsweise erhöhen wir die mediale Kompression leicht, halten das Vibrato durch eine feine Muskelaktivität im M. Thyroepiglotticus an, wenn wir es wünschen. Und mit noch ein paar weiteren Änderungen können wir den Sound in Richtung einer Belting Qualität verschieben.
Auch innerhalb anderer Stilistiken können wir die mediale Kompression weiter erhöhen, sodass ein härterer Sound entsteht. All das bewegt sich aus dem Optimum heraus und wir müssen lernen, wie weit wir gehen können oder auch wollen, ohne dass die Stimmlippen auf Dauer Schaden nehmen. Die gute Nachricht ist: Es ist sehr vieles möglich.

Der subglottische Luftdruck
Ein anderes Wort ist Luftdruck oder genauer subglottischer Luftdruck. Damit bezeichnen wir den Druck der Luft, wie er durch die Lungen, die Bronchien und die untere Luftröhre von unten an die Stimmlippen trifft.
Dieser Druck regelt sich im Idealfall durch die Zusammenarbeit von Stimmlippen, Luftdruck und Kehlkopfstellung, wiederum in Zusammenarbeit mit vielen Muskeln des Vokaltrakts oberhalb der Stimmlippen.
Um die Druckverhältnisse, die ganz grundsätzlich und aufgrund unserer Biologie in unserem Körper herrschen, besser zu verstehen, ist es gut, die Doppelventilfunktion zu kennen. Denn sowohl Stimmlippen als auch die Taschenfalten sind in ihrer ursprünglichen Version ein Atemventil. Das nutzen wir modifiziert beim Singen. Und die Druckverhältnisse und auch die neurologischen Gegebenheiten leiten sich aus dieser Funktion her, die wir beim Singen – gewusst wie – einsetzen können.
Durch zu viel Bauchmuskelaktivität erhöhen wir den subglottischen Luftdruck meist so stark, dass die Stimmlippen als Schutz mit zu viel medialer Kompression reagieren müssen. Aber auf Dauer ist es nicht günstig, wenn der Druck zu hoch ist. Die Stimme wird zwar lauter, was manche dann als ein gutes Zeichen sehen, aber die Differenzierbarkeit leidet und im schlimmsten Fall bekommen wir Ödeme oder Knötchen auf den Stimmlippen. Das betrifft im Besonderen uns Frauen, da unsere Stimmlippen nicht so viel Muskelmasse zum Schutz haben, wie die männlichen Stimmlippen, die in der Mutation wachsen und an Muskelmasse zunehmen. Daher übrigens auch ihre tieferen Stimmen.
Ähnlich wie die mediale Kompression, ist auch der subglottische Luftdruck bei manchen Stilmitteln innerhalb der Popularmusik höher als das Optimum wäre. Das ist nicht schädlich, wenn wir eine gute Wahrnehmung dafür haben und wissen, wie wir das steuern können. Und wir sollten es vor allem nicht dauerhaft, sondern als Stilmittel oder musikalischen Ausdruck anwenden.
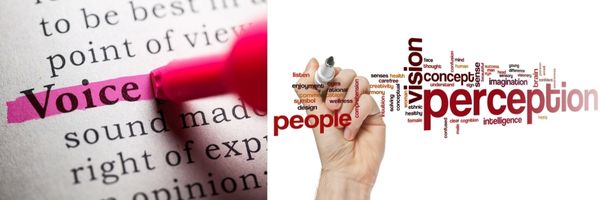
Die Wahrnehmung schulen
Dabei kann eine Schwierigkeit entstehen. Wenn unser Stimmtraining uns nicht gelehrt hat, auf diese Dinge zu achten, können wir sie bei uns nicht wahrnehmen.
Wenn wir vor allem über das Prinzip „Vormachen – nachmachen“ gelernt haben, kann es sein, dass wir uns nicht wirklich von innen heraus wahrnehmen können, sondern uns ausschließlich über das klangliche Ergebnis kontrollieren, das wir außen hören.
Und interessant ist dabei auch, dass unser Nervensystem so eingestellt ist, dass wir immer weniger von unserer Stimme wahrnehmen, je höher der Druck wird. So können wir die Menge an Druck oft nicht beurteilen. Das ist ein Phänomen, wie unser Nervensystem von Natur aus reagiert, weil es immer den besten Modus für Schutz in jeder Situation für uns sucht.
Deshalb besteht ein wichtiger Teil der Arbeit innerhalb der Rabine-Methode darin, in Richtung Öffnung und Optimum zu gehen, um die Wahrnehmung für alle diese Dinge zu schulen und zu trainieren. Für manche Sänger:innen aus dem Bereich der populären Stile scheint es dann so, als ob wir vom Klang erst einmal in eine eher klassische Richtung gehen.
Ja, das stimmt. Und wir tun das, um die Wahrnehmungsfähigkeit für diese feinen Regelungen innerhalb unserer Stimmfunktion deutlich zu erhöhen. Damit haben wir einen guten Einfluss auf unsere Klangqualität.
Erst von dort aus haben wir die Möglichkeit, differenziert mit diesen vielen, sehr unterschiedlichen klanglichen Elementen zu arbeiten, wie sie in der Popularmusik vorkommen.
Mal ganz abgesehen davon, dass es eine wunderbare Art ist, uns für ein Konzert einzusingen. Oder nach einem Konzert die Stimme zu regenerieren und ein cool-down zu machen.
Aber das wäre ein neues Thema, was wir sicherlich auch irgendwann aufgreifen werden.

Ein Kommentar
Liebe Ulla, liebe Hilkea,
auf der Suche nach dem Bernoulli Effekt bin ich auf eurer Seite gelandet. Ich möchte euch danken für die klare und leicht verständliche Darstellung immer wieder wichtiger Themen.
Der Hinterkopf beherbergt ja doch noch einiges, aber so eine kompakte Auffrischung tut doch sehr gut. Vielen Dank euch beiden und weiterhin viel Spaß und Erfolg bei eurer Stimmarbeit.
Liebe Grüße Moni